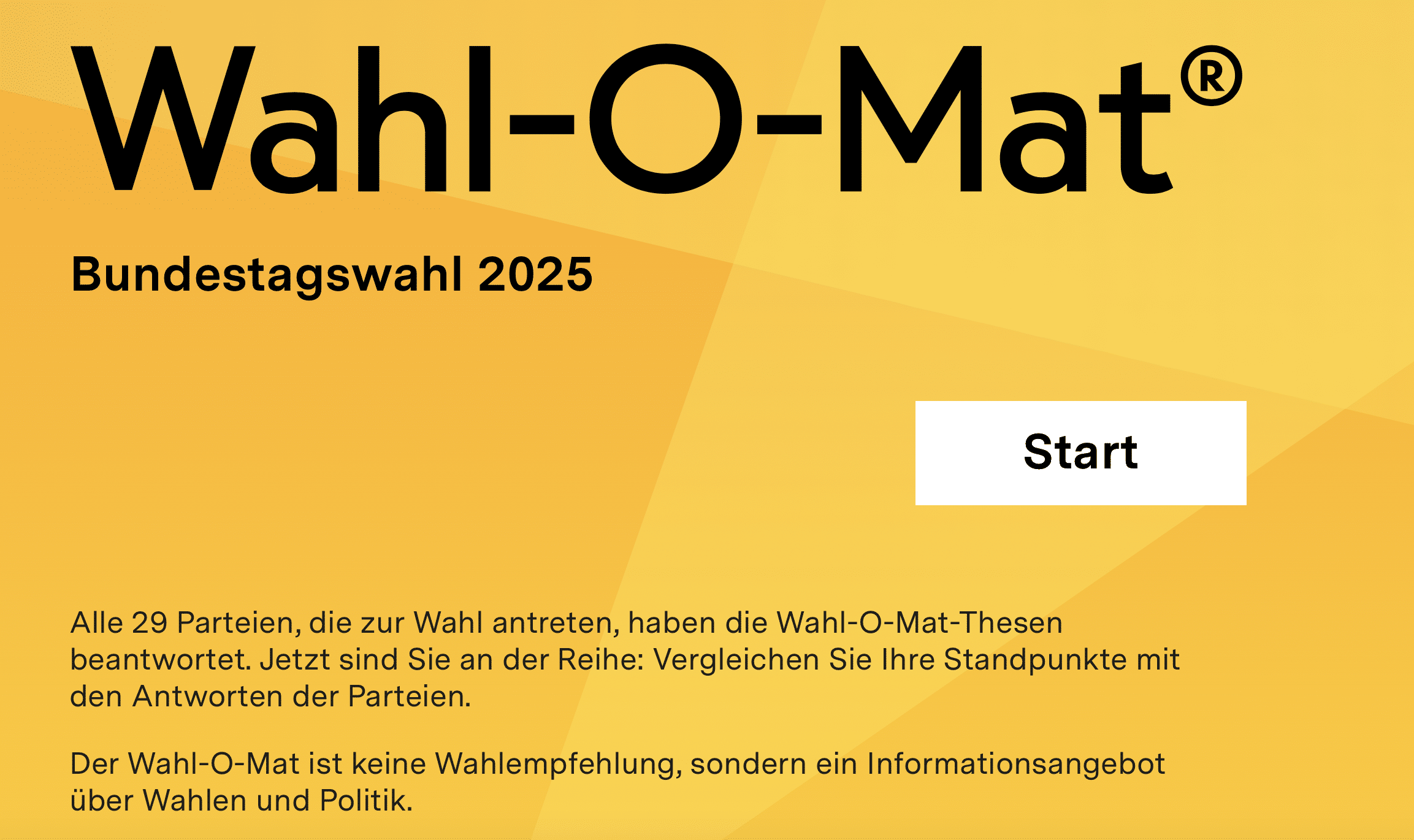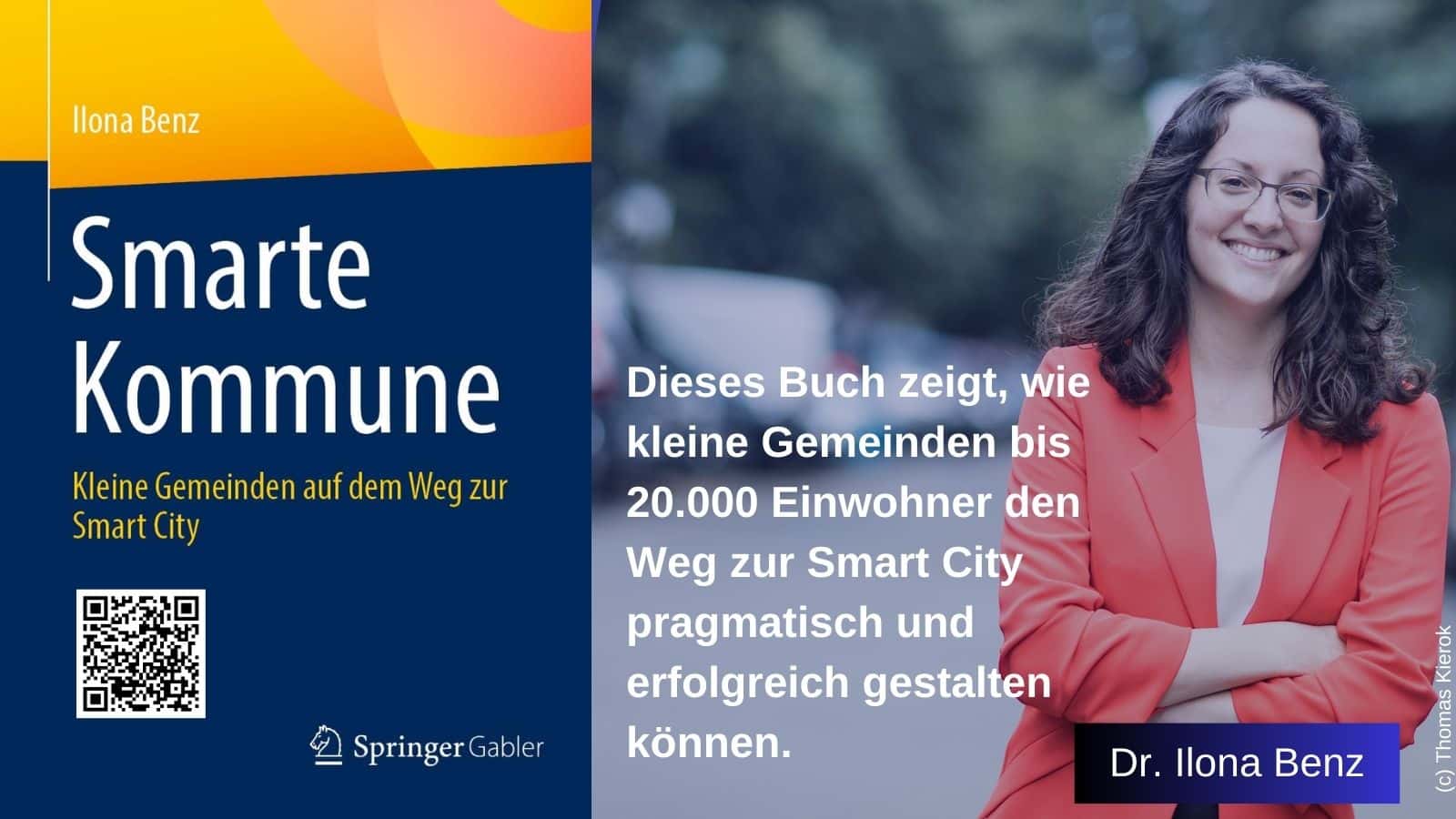Im Z-M-I, dem Zehn-Minuten-Internet Newsletter berichten Franz-Reinhard Habbel und Gerd Landsberg jeden Sonntag über interessante Links (heute u.a. Digitalministerium in Brandenburg) aus dem Internet für Bürgermeister:innen und Kommunalpolitiker:innen.

Brandenburgs erstes Digitalministerium steht
Das Land Brandenburg stellt sich in der Digitalisierung neu auf. Bisherige Aufgaben verschiedener Ministerien wurden jetzt in einem Ministerium gebündelt. Das Vorgehen hat nicht zuletzt durch schnelle Entscheidungen Pilotcharakter für ganz Deutschland, denn das Ministerium der Justiz wurde zum 1. Februar 2025 zu einem Ministerium der Justiz und für Digitalisierung unter der Leitung von Minister Dr. Benjamin Grimm erweitert. Staatssekretär und Amtschef ist Ernst Bürger. Mit der Errichtung der Abteilung 4 „Digitalpolitik, E-Government und IT-Leitstelle“ sind die organisatorischen Weichen für eine entschlossene Gestaltung der Digitalisierung des Landes Brandenburg gestellt. Die Abteilung ist u.a. für die Koordinierung der Digitalstrategie Brandenburg sowie die zentrale Koordinierung, strategische Planung und Steuerung des E-Government und des IT-Einsatzes in der Landesverwaltung zuständig. Neben der Konzeption und dem Management der ressortübergreifenden digitalpolitischen Gesamtstrategie, der Begleitung der Umsetzung der Landesstrategien für Künstliche Intelligenz und Open Data sowie der Registermodernisierung befasst sich die Abteilung auch mit der Steuerung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung.
Im Rahmen der Regierungsneubildung nach der Landtagswahl 2024 sind die Zuständigkeiten für die Bereiche der Digitalisierung vom Ministerium des Innern und für Kommunales, vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie von der Staatskanzlei zum Ministerium der Justiz und für Digitalisierung des Landes Brandenburg übergegangen. Im Zuge der Umressortierung wurde auch die Zentrale Normprüfstelle integriert.
Nach den Worten von Staatssekretär Ernst Bürger soll die Zusammenarbeit mit den Kommunen und dem kommunalen Dienstleister DIKOM intensiviert werden. Angedacht ist auch die Einrichtung eines zentralen Digitalbudgets für das Land Brandenburg. Der Rollout der OZG-Umsetzung soll beschleunigt, die Datenstrategie weiterentwickelt und KI-Projekte strukturiert vorangebracht werden. Für den Bereich der Justiz soll die eAkte in Strafsachen umgesetzt werden.
KI-Marktplatz der Bundesverwaltung: Neue Plattform soll Transparenz beim Einsatz künstlicher Intelligenz schaffen
Die Bundesverwaltung hat einen Schritt zur Digitalisierung ihrer Dienste unternommen. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat präsentierte eine neue Online-Plattform, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Behörden transparent machen soll. Der Marktplatz der KI-Möglichkeiten (MaKI) ist seit heute unter kimarktplatz.bund.de erreichbar.

Mehr kommunale Selbstverwaltung wagen: Städte und Gemeinden ins Zentrum der Politik rücken
Unsere Kommunen sind das Rückgrat unseres Landes. Sie gestalten die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort und sorgen für eine funktionierende Daseinsvorsorge. Gute Kitas und Schulen, intakte Straßen und Plätze, moderne Sportstätten und eine leistungsfähige Verwaltung sind die Grundlage für Lebensqualität, Zufriedenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Doch die Handlungsspielräume der Kommunen sind in den vergangenen Jahren immer enger geworden. Finanzielle Mittel fehlen, die Infrastruktur ist vielerorts marode, und die Zahl der Vorgaben aus Land, Bund und EU nimmt stetig zu. Diese wachsenden bürokratischen Anforderungen treffen auf Verwaltungen, die mit immer weniger Personal immer mehr leisten sollen.
Was wir jetzt brauchen, ist ein echter Befreiungsschlag für die kommunale Selbstverwaltung. Die Städte und Gemeinden müssen wieder mehr Luft zum Atmen bekommen – mit mehr Entscheidungsfreiheit und weniger bürokratischen Fesseln. Vorgaben und Berichtspflichten müssen reduziert oder ganz abgeschafft werden, um die Eigenverantwortung vor Ort zu stärken. Nur so kann es gelingen, die Identifikation der Menschen mit ihrer Heimat zu fördern und extremistischen Strömungen entgegenzuwirken.
Diese Neuausrichtung darf kein langfristiges Ziel bleiben – sie muss nach der Bundestagswahl von der neuen Bundesregierung entschlossen angegangen werden. Es braucht ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Kommunen, zu mehr finanzieller Eigenständigkeit und zur konsequenten Entlastung von Bürokratie. Städte und Gemeinden müssen wieder zu echten Gestaltern werden – denn nur vor Ort weiß man, was vor Ort wirklich gebraucht wird (Gerd Landsberg).

Deutschland ist EU-Schlusslicht im Wohnungsbau
Wirtschaftlich läuft es in Deutschland in einigen Bereichen schlechter als in den EU-Nachbarstaaten. Besonders eklatant steht es jedoch um den Wohnungsbau, der sich in den weiteren Ländern nach einer Talfahrt erholen wird – doch in Deutschland sehen Experten keine Anhaltspunkte für Besserung.
Wo Kitas um Kinder werben
In vielen ostdeutschen Kitas herrscht Mangel – an Kindern. Die traditionell gut ausgebauten Kitastrukturen bekommen durch einen Geburtenknick Probleme – wie etwa in Thüringen.
Bundesregierung will Fußverkehr stärken – unter anderem mit kürzeren Ampelschaltungen
Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat das rot-grüne Kabinett eine Strategie beschlossen, um den Fußverkehr zu stärken. Das Ziel: Mehr Sicherheit und Barrierefreiheit.
Zukunftsängsten entgegenwirken, Doomscrolling stoppen – wie man sich nicht in schlechten Nachrichten verliert
Schlechte Nachrichten dominieren Informationsportale und die Newsfeeds der sozialen Netzwerke. Darin verliert man sich leicht und klickt und klickt und klickt immer weiter – mit negativen Folgen für die eigene Psyche. Zukunftsängste sind entsprechend weit verbreitet, wie eine BARMER Studie zeigt. Sie sollten aber nicht das gesamte Leben beherrschen. Was es mit Doomscrolling auf sich hat und was sich dagegen unternehmen lässt.
Digitaler Gewerbesteuerbescheid
Der Gewerbesteuerbescheid bedeutete in seiner bisherigen Papierform für zahlreiche Unternehmen einen hohen Erfüllungsaufwand. Mit dem digitalen Gewerbesteuerbescheidkann nun dieser Vorgang optimiert werden, so dass die Steuerpflichtigen und ihre Steuerbüros, die Bescheide maschinell weiterverarbeiten können. Von einem elektronisch übermittelten Steuerbescheid profitieren jedoch nicht nur die Unternehmen. Auch für die Kommunen bietet er eine Chance, um Prozesse und Abläufe zu verbessern und effizienter zu gestalten und so personelle Kapazitäten freizumachen, die an anderer Stelle benötigt werden.
KI-Aktionsgipfel: EU-Kommission kündigt Investitionen in Milliardenhöhe an
Beim „AI Action Summit“, der am 10. und 11. Februar 2025 unter französischem Vorsitz in Paris ausgerichtet wurde, diskutierten Staats- und Regierungschefs, internationale Organisationen und Technologie-Unternehmen über neue Rahmenbedingungen für den globalen Fortschritt im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI). Die Europäische Kommission (KOM) kündigte dabei an, 200 Mrd. Euro an Investitionen in KI zu mobilisieren. Daneben schlossen sich mehr als 60 europäische Unternehmen zu einer „EU AI Champions Initiative“ zusammen.
Angriffe im Sekundentakt
Krachend verfehlt die Bundesregierung die eigenen Ziele der Nationalen Sicherheitsstrategie. Das bringt das Land in eine prekäre Lage. Der Digitalverband legt eine schonungslose Analyse vor.
Ihnen wurde der Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie in abonnieren


KI-Gipfel in Paris: Deutschland in der Zuschauerrolle
„Deutschland und Frankreich müssen der Motor für Künstliche Intelligenz in Europa sein“, forderte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Henrik Wüst auf der Berliner Zukunftskonferenz „Von der Kohle zur KI“. Doch während Europa langsam aufwacht und Frankreich große Schritte nach vorne macht, scheint Deutschland zu zögern – gerade jetzt, wo es darauf ankommt.
Auf dem internationalen KI-Gipfel in Paris mit über 1.500 Teilnehmern aus aller Welt wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Unter den Gästen: Größen wie Sundar Pichai, CEO von Google, und Sam Altman, der Kopf hinter ChatGPT. Emmanuel Macron nutzte die Bühne, um die Vorreiterrolle Frankreichs zu untermauern: Mehr als 100 Milliarden Euro sollen in den Aufbau von KI-Infrastruktur fließen, teils durch private Investitionen, teils durch EU-Gelder. Der Plan: „KI-Gigafabriken“ und umfassende Ausbildungsinitiativen, um Europa fit für den globalen KI-Wettbewerb zu machen. Indien, das Partnerland des Gipfels, symbolisierte Frankreichs internationales Netzwerkdenken.
Und Deutschland? Bundeskanzler Olaf Scholz war zwar vor Ort, setzte aber eher auf Diplomatie als auf konkrete Ambitionen. Sein Appell für eine einfachere Regulierung in Europa mag vernünftig klingen, doch Visionen für Investitionen oder eine strategische Partnerschaft mit Frankreich blieben aus.
Es hätte eine Chance sein können: Eine deutsch-französische KI-Allianz, getragen von Unternehmen und der Politik beider Länder, hätte nicht nur Europa stärken, sondern auch die eigene digitale Infrastruktur auf ein neues Niveau heben können. Ein Investitionsziel von 200 Milliarden Euro beider Länder wäre realistisch gewesen – ambitioniert, aber nicht unerreichbar. Stattdessen verharrt Deutschland in der Zuschauerrolle, während die USA und China längst den Ton angeben.
Dass es auch anders geht, zeigt Nordrhein-Westfalen. Das einst von Kohle und Stahl geprägte Land geht mit großen Schritten in die Zukunft. Unter der Führung von Ministerpräsident Henrik Wüst positioniert sich NRW als europäisches Innovationszentrum – mit den meisten Forschungseinrichtungen und einem klaren Fokus auf den Transfer von Wissenschaft in die Praxis. Doch die Frage bleibt: Wie lange kann Europa noch auf Deutschland als digitalen Mitgestalter warten? (Franz-Reinhard Habbel)

Neues aus den Kommunalen Spitzenverbänden
DST: Das Herzstück muss der Umweltverbund sein
DStGB: Städte und Gemeinden fordern Bundeszuständigkeit für Abschiebungen
DLT: Operationsplan und Zivilschutz: „Wir müssen vorbereitet sein“
GStBRLP: „Neues Bürokratiemonster und weitere Steuererhöhungsspirale drohen“
GtBW: KiTaFlex – ein Rahmenkonzept zur Erprobung von Angebotsformen und Personalstruktur
HSGB: Hessischer Städte- und Gemeindebund stellt wichtige personelle Weichen für die Zukunft
HST: Finanzausgleichsmasse deutlich zu gering
SHGT: 24. März: Forum Recht der kommunalen Wirtschaft
NWStGB: Bezahlkarte: Flickenteppich statt einheitlicher Lösung
Kopf der Woche: Heike Langguth wird Bürgermeisterin der Stadt Erfurt
Buch der Woche: Dennoch sprechen wir miteinander von Stephan Lamby
Stephan Lamby hat im Zeitraum eines Jahres vier Länder bereist, um ein Gefühl für die Ängste radikalisierter Bürger zu entwickeln. Er wollte verstehen, warum die Demokratie vielerorts auf der Kippe steht. Er war in den USA unterwegs, in Argentinien, in Italien und natürlich in Deutschland. Seine Reisen führten ihn auch in die eigene Familie und in den eigenen Freundeskreis. Einige Begegnungen waren sehr schmerzhaft, andere ermutigend. Außerdem taucht er tief in die Geschichte ein – in die Geschichte seiner Familie, auch in die Geschichte der Länder, die ihm vertraut sind. Gut hundert Jahre nach dem Aufkommen des historischen Faschismus und achtzig Jahre nach dessen Ende geht er der Frage nach, ob der Begriff Faschismus für die aktuelle politische Auseinandersetzung noch taugt. Stephan Lamby lernte Menschen im ehemaligen Wohnhaus von Benito Mussolini kennen und in Graceland, dem Anwesen von Elvis Presley. Er beobachtete den argentinischen Präsidenten Javier Milei aus der Nähe, sprach mit seinem Cousin, der beim Sturm aufs Kapitol dabei gewesen war, und mit einem Arzt in Gera, der sich für die AfD engagiert. Lamby hat Feinde der Demokratie kennengelernt, aber auch Menschen, die sich den Feinden der Demokratie in den Weg stellen. Fast immer haben sich die Gespräche gelohnt. Doch es gab auch Grenzen.
+++ Bitte denken Sie beim Bücherkauf an den örtlichen Buchhandel+++
Zahl der Woche: 33 Tage dauert es im Durchschnitt einen Termin im Bürgeramt in Berlin zu bekommen (Quelle TSP)
Chatbot der Woche: Gemeinde Großenkneten ist Vorreiter im Landkreis Oldenburg
Tweet der Woche: Stadt Leipzig
121.000 Gäste mehr als im Vorjahr besuchten 2024 die städtischen Museen in Leipzig. Das ist ein Plus von 15 Prozent.
Zu guter Letzt: Verfolgungsjagd: Polizeipferd schnappt mutmaßlichen Drogendealer
BIld Stadt Brilon CC BY-SA 3.0
+++
Der ZMI kann kostenlos hier abonniert werden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ihr Franz-Reinhard Habbel