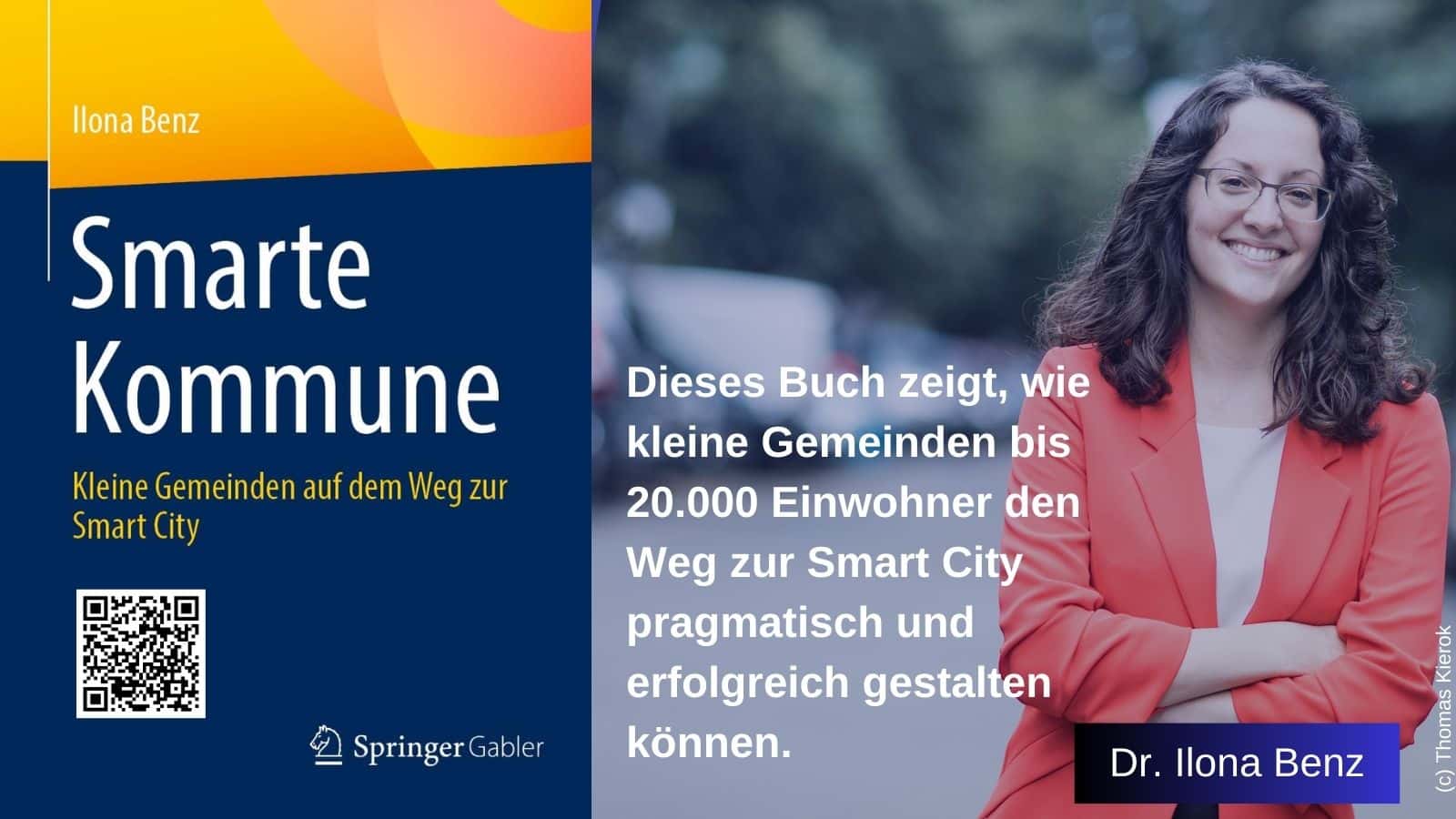Im Z-M-I, dem Zehn-Minuten-Internet Newsletter berichten Franz-Reinhard Habbel und Gerd Landsberg jeden Sonntag über interessante Links (heute u.a. Grünes Licht für Finanzpaket 500 Mrd. Euro) aus dem Internet für Bürgermeister:innen und Kommunalpolitiker:innen.

Einigung zwischen Union, SPD und Grünen über Milliardenpakete und Grundgesetzänderungen

Nach intensiven Verhandlungen und einer langen Nachtsitzung haben sich die Spitzen von Union, SPD und Grünen auf ein milliardenschweres Maßnahmenpaket geeinigt. Die Verständigung war notwendig, um die erforderliche Zweidrittelmehrheit für drei Grundgesetzänderungen zu sichern, die am Dienstag im Bundestag beschlossen werden sollen.
Im Kern umfasst das Paket folgende Maßnahmen:
Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro: Das Sondervermögen bleibt bei 500 Milliarden Euro, die Laufzeit wird jedoch von ursprünglich 10 auf 12 Jahre verlängert.
Pro Jahr stehen somit rund 41,6 Milliarden Euro zur Verfügung, wovon 33 Milliarden Euro auf den Bund entfallen.
Infrastruktur-Sondervermögen mit strengen Kriterien:In den Gesetzestext wird das Prinzip der Zusätzlichkeit aufgenommen. Das bedeutet, dass laufende Staatsaufgaben und konsumtive Ausgaben nicht aus dem Sondervermögen finanziert werden dürfen. Es wird eine Investitionsquote von mindestens 10 Prozent des Bundeshaushalts festgelegt. Die genaue Umsetzung soll durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) geprüft und konkretisiert werden.
Verdopplung der Mittel für den Klima- und Transformationsfonds: Ursprünglich sollten aus dem Sondervermögen 50 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Nach den Verhandlungen wurde dieser Betrag auf 100 Milliarden Euro erhöht. Dieser Punkt war für Friedrich Merz besonders umstritten und wurde als „härtester Brocken“ bezeichnet.
Schuldenbremse und Verteidigungsausgaben: Die Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben bleibt bestehen. Die Obergrenze für diese Ausnahme liegt weiterhin bei 1 Prozent des BIP.
Erweiterung des Sicherheitsbegriffs: Bereits am Donnerstag hatte Merz zugesagt, dass der Sicherheitsbegriff in der Grundgesetzänderung erweitert wird. Dies bedeutet, dass künftig auch Zivil- und Bevölkerungsschutz, Geheimdienste, IT-Sicherheit sowie die Unterstützung für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten unter die Ausnahme fallen. Nach der Zustimmung des Bundesrates soll zudem die seit Langem diskutierte Finanzhilfe für die Ukraine in Höhe von drei Milliarden Euro freigegeben werden.
Erweiterung der Flexibilitätsklausel für die Länder: Die Flexibilitätsklausel im Grundgesetz, die bislang nur für den Bund galt, soll künftig auch für die Länder anwendbar sein. Die Grenze wird auf 0,35 Prozent des BIP festgelegt. Dies bedeutet eine finanzielle Flexibilität in Höhe von ca. 16 Milliarden Euro für alle Bundesländer zusammen.
Diese Einigung stellt einen bedeutenden Schritt für die finanzpolitische Zukunft Deutschlands dar. Die geplanten Grundgesetzänderungen sollen am Dienstag im Bundestag beschlossen werden.
Haushaltsausschuss befasst sich mit geplanten Milliarden-Paketen
Der Haushaltsausschuss des Bundestags kommt heutezusammen, um sich mit den Gesetzentwürfen für die geplanten Grundgesetzänderungen zu befassen. Er will konkrete Beschlussempfehlungen für die entscheidende Plenumssitzung am Dienstag erarbeiten.
Initiative für einen handlungsfähigen Staat – Reformen für eine starke Demokratie
Die Initiative für einen handlungsfähigen Staat verfolgt das Ziel, die Effizienz und Bürgernähe der deutschen Verwaltung durch umfassende Reformen zu stärken. Gegründet von der Medienmanagerin und Aufsichtsrätin Julia Jäkel, den früheren Bundesministern Peer Steinbrück und Thomas de Maizière sowie dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle, sollen die Expertinnen und Experten gemeinsam konkrete Ansätze erarbeiten, wie staatliche Strukturen in Deutschland zukunftsfähig gestaltet werden können. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für das Vorhaben die Schirmherrschaft übernommen. Die vier Initiatorinnen und Initiatoren werden dabei von einer Gruppe von über 50 erfahrenen Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft unterstützt. Außerdem sollen Dialogformate mit Studierenden und Alumni der Hertie School und Bucerius Law School, insbesondere jüngeren Praktiker aus dem öffentlichen Sektor, den Prozess flankieren. Die Gruppe hat jetzt ihren Zwischenbericht vorgelegt.
Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau. Die CDU-Ideen
Bürokratieabbau und Staatsreform – die Evergreens des politischen Forderungskatalogs. Die CDU legt ein Papier mit 44 konkreten Einzelmaßnahmen vor, um die Verwaltung zu modernisieren und verschlanken.
Bürokratieabbau und ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln
Der Wissenschaftliche Beirat des BMWK hat sein neues Gutachten zum Bürokratieabbau und ergebnisorientierten Verwaltungshandeln im BMWK vorgestellt.
EU-Kommission will mit allen Mitteln abschieben
Mit einem neuen Gesetzesvorschlag will die EU-Kommission Abschiebungen erleichtern. Neben langer Haft und Einreiseverboten öffnet der Entwurf auch Türen für EU-weite Datenträgerauswertungen und eine intransparente Risikoeinschätzung mit schweren Folgen.
Starke Kommunen – starke Demokratie
Wie können Kommunen gestärkt werden, um den zunehmenden Herausforderungen gerecht zu werden? Gerd Landsberg, langjähriger Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und nun Ehrengeschäftsführer, spricht im Interview mit dem Demokratischen Salon über Bürokratieabbau, Digitalisierung, die Bedeutung kommunaler Selbstverwaltung und erforderliche Grundgesetzänderungen zur Stärkung der Kommunen. Er mahnt an, dass ohne Strukturreformen und effizientere Verfahren viele Vorhaben ins Stocken geraten. Zudem thematisiert er das wachsende Problem von Angriffen auf Kommunalpolitiker und die Frage, wie wir die Übernahme eines Bürgermeister- oder Ratsmandats attraktiver machen können. Ein hochaktuelles Gespräch über die Zukunft der kommunalen Demokratie!
Lagebild zur digitalen Gesellschaft
Der D21-Digital-Index ist Deutschlands wichtigstes Lagebild zur Digitalisierung der Gesellschaft. Er zeigt, wie tief die digitale Transformation verschiedene Lebensbereiche durchdringt und wie gut Bürger*innen mit den Anforderungen des Wandels umgehen können. Gleichzeitig offenbart er Spaltungen und Herausforderungen: Wer profitiert, wer droht abgehängt zu werden? Der D21-Digital-Index ist mehr als eine Analyse: Er ist Basis für wirkungsvolles Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um die Resilienz im digitalen Wandel zu stärken und gemeinsam eine inklusive digitale Zukunft zu gestalten, in der alle von den Chancen der Digitalisierung profitieren.
Spitzenreiter Deutschland: Regierungen fragen massenhaft Nutzerdaten an
Ob per Gerichtsbeschluss oder manchmal auch unbegründet: Große Technologieunternehmen können dazu verpflichtet werden, viele Daten von Nutzernpreiszugeben. Mitunter haben Regierungen ein schwieriges Verhältnis zum Datenschutz.
Digitale Verwaltung – Inspirationen für die nächste Bundesregierung
In einer Live-Sendung am 24. März 2025 um 18:00 Uhr sprechen wir gemeinsam mit Torsten Frenzel(eGovernment Podcast), Dr. Dorit Bosch, Franz-Reinhard Habbel und Felix Schmitt über die Verwaltungsdigitalisierung und geben der neuen Bundesregierung ein paar Inspirationen mit auf den Weg.

Reinhören und mitreden! Hier gehts direkt zum Stream:
Riverside – https://lnkd.in/ef7TA4Hi – inklusive Chat
YouTube – https://lnkd.in/emSZ4Tdd
LinkedIN – https://lnkd.in/eDgcPJiH

Zivile und militärische Verteidigung zusammen denken – Koalitionsvertrag schlank gestalten
Die sicherheitspolitische Lage für Deutschland und Europa spitzt sich weiter zu. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hält an, während die USA sich zunehmend von Europa abwenden. Der amerikanische Präsident scheint einen Deal mit Russland anzustreben, bei dem europäische Interessen – und möglicherweise auch die der Ukraine – kaum eine Rolle spielen. Auf den Schutzschirm der USA können wir uns nicht mehr verlassen.
Daraus folgt eine klare Konsequenz: Deutschland muss seine Verteidigungsfähigkeit stärken – nach dem Motto „Wer den Frieden will, muss für den Krieg gerüstet sein.“ Die Entscheidung, Militärausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen und das Grundgesetz entsprechend zu ändern, ist daher richtig, greift aber zu kurz. Militärische und zivile Verteidigung müssen zusammen gedacht werden.
Deutschland befindet sich zwar nicht im Krieg, aber auch nicht im Frieden. Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur und gezielte Sabotageakte sind eine Realität. Eine belastbare militärische Einsatzbereitschaft setzt eine ebenso belastbare zivile Verteidigungsstruktur voraus. Daher ist es richtig, auch zivile Verteidigung, Cyberabwehr und den Schutz kritischer Infrastruktur in das Sicherheitskonzept einzubeziehen – wie es von den Grünen vorgeschlagen wurde. Man kann nur hoffen, dass am Ende ein tragfähiger Kompromiss gefunden wird.
„Ein schlanker Koalitionsvertrag als Signal des Vertrauens“
Nach den Sondierungsgesprächen beginnen nun die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD. Dabei sollte ein möglichst schlanker Koalitionsvertrag das Ziel sein – ein Dokument, das sich auf klare Leitlinien konzentriert, statt jede Einzelheit festzuschreiben.
Konrad Adenauer besiegelte seine erste Koalition mit einem Handschlag, seine zweite Koalitionsvereinbarung umfasste gerade einmal drei handgeschriebene Seiten. Auch wenn das heute nicht der Maßstab sein muss, gilt: In der Kürze liegt die Würze. Eine kompakte Koalitionsvereinbarung wäre ein starkes Signal an die Gesellschaft: Diese Regierung vertraut einander und setzt auf pragmatische, anpassungsfähige Politik.
Daher sollte eine zentrale Klausel im Vertrag verankert werden: Wenn sich die politischen Rahmenbedingungen durch globale oder nationale Entwicklungen grundlegend ändern, müssen die vereinbarten Ziele überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
So wird eine Regierung handlungsfähig bleiben – auch in Zeiten, die von Unsicherheit und neuen Herausforderungen geprägt sind. (Gerd Landsberg)

nformationssuche frisst ein Viertel der Arbeitszeit von Büroangestellten
Zehn Stunden pro Woche benötigen deutsche Büroangestellte zur Informationssuche. Zugriff auf das benötigte Wissen erhalten sie mehrheitlich erst auf Nachfrage.
Uneinheitliche Cybersicherheitsstandards: Kommunen ohne klare Strategie
Aktuell gibt es bei der IT-Sicherheit von Kommunen noch viele Mängel. Eine Studie klärt über die Defizite und mögliche Maßnahmen auf.
Überschuss aus Parkgebühren für Spielplätze: Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg macht erstmals von neuer Regel Gebrauch
Zwei Spielplätzen in Berlin-Lichtenrade kommen überschüssige Einnahmen aus der Tempelhof-Schöneberger Parkraumbewirtschaftung zugute. Der öffentliche Raum und soziale Belange sind jetzt dafür vorgesehen.
Podcast: Die KGSt-Kommunal-WG
Die KGSt hat einen Podcast: Die KGSt-Kommunal-WG. In der Kommunal-WG dreht sich alles um modernes Management. In der vorletzten Folge ging es zum Beispiel um das Thema einfache Sprache und in diesem Zusammenhang um die Formularwerkstatt der Stadt Köln. In der aktuellen Folge, die am 11. März veröffentlicht wurde, geht es um das Thema rollenbasiertes Arbeiten und Selbstorganisation.

500 Milliarden: Mit der „Umlaufmappe“ brauchen wir 50 Jahre
500 Milliarden Euro für die Infrastruktur in Deutschland. Wird die Wirtschaft endlich wieder wachsen? Haben die vielen Engpässe in der Verkehrsinfrastruktur bald ein Ende? Sitzen die Schülerinnen und Schüler bald in modernisierten Klassenzimmern? Jetzt kommt es auf die Umsetzung der Investitionen an. Ohne grundlegende Strukturveränderungen wird es nicht gehen. Es lohnt sich, in diesen Tagen an Wolfgang Schäuble zu erinnern, der davor gewarnt hat, dass die Mobilisierung von Finanzmitteln allein die Probleme nicht löst.
Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Die 500 Milliarden für die Infrastruktur sind ein richtiger und wichtiger Schritt. Das gilt auch für den Klimaschutz, der in den nächsten Jahrzehnten eine zentrale Aufgabe aller Ebenen sein wird. Wolfgang Schäuble schreibt in seinen Memoiren bemerkenswerte Sätze: „Nicht der Mangel an investiven Mitteln im Bundeshaushalt war das Problem, vielmehr liegt der Knackpunkt seit Jahren in unserer schwerfälligen Planungs- und Genehmigungsbürokratie“. Und weiter: „Die Wucherungen des Verwaltungsapparates mit allen möglichen unsinnigen Bewilligungshürden und die Segmentierungen der Zuständigkeiten erreichen nicht selten kafkaeske Ausmaße und verhindern, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird“.
Recht hat er. Die aktuelle Situation ist damit treffend beschrieben. Was ist nun zu tun, damit die Mittel schnell wirksam werden? Die Lösung kann nur eine radikale Staatsmodernisierung von Stein-hardenbergschen Ausmaßen sein. Nämlich indem die Kommunen mehr Freiräume für eigenverantwortliches Handeln und ausreichende Mittel bekommen, indem die Ministerien ihnen mehr zutrauen, das Richtige zu tun, statt sie mit Berichtspflichten zu gängeln. Den Kommunen muss aber auch klar sein, dass sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben mehr zusammenarbeiten müssen.
Mit der Umlaufmappe werden wir nicht einmal fünf Millionen Euro von 500 Milliarden Euro schnell und effektiv in Maßnahmen umsetzen
Ohne digitale Prozesse, ohne Projektmanagement wird es uns nicht gelingen, die vorhandenen Mittel schnell und effektiv in notwendige Maßnahmen umzusetzen. Wir brauchen neue Organisationsformen, die Prozesse ganzheitlich betrachten und beschleunigen. Beispiel Hessentage: Das Land Hessen stellt einer Kommune jährlich Mittel in zweistelliger Millionenhöhe für eine Zukunftswoche zur Verfügung. Die Stadt oder Gemeinde löst damit Probleme vor Ort. Kern ist ein Projektmanagement, das von Anfang an alle Akteure, zum Beispiel Feuerwehr, Sicherheitorgane, Verkehrsunternehmen,Ordnungsämter etc. an einen Tisch bringt, um das Ziel gemeinsam zu erreichen. Auch der Umbau der Emscherregion im Ruhrgebiet wurde mit dieser Methode erfolgreich gemanagt. Am Runden Tisch geht es um Fragen wie: Wie kann ich den Handlungsspielraum optimal nutzen, statt nur die Risiken zu betrachten?
Die Kommunen müssen jetzt nicht nur die Sanierung der alten Infrastruktur auf den Weg bringen, sondern ihre Zukunftsprojekte definieren, die die nächsten 30 bis 50 Jahre bestimmen.
Digitalisierung als Enabler, nicht als Selbstzweck
Notwendig ist eine neue Form der Kooperation und Bündelung, wie sie gerade in Sachsen-Anhalt mit einer Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht werden soll. Dort sollen künftig übertragene Aufgaben künftig in einem Shared Service Center erledigt werden. Das macht die Verwaltung effizienter und serviceorientierter.
Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle, reicht aber allein nicht aus, um voranzukommen. Notwendig ist ein tiefgreifender Strukturwandel, der über die reine IT-Modernisierung hinausgeht. Ein digitales Bauantragsverfahren nützt wenig, wenn dahinter ein zersplittertes Kompetenzgerangel zwischen Ämtern und Behörden steht.
Andere Länder zeigen, wie es geht: Estland hat mit automatisierten Genehmigungsverfahren im Baubereich bis zu 80 Prozent der Antragsdauer eingespart. Dänemark nutzt KI-gestützte Prüfmechanismen, um Subventionen automatisch zu bewilligen, wenn alle Kriterien erfüllt sind. Auch Deutschland muss digitale Technologien nicht nur einführen, sondern so einsetzen, dass sie Verwaltungsprozesse grundlegend verändern.
Ein zentraler Hebel ist dabei die Bündelung gleichartiger Aufgaben: Statt, dass 10.000 Kommunen Wohngeldanträge, Meldeangelegenheiten oder Kfz-Zulassungen parallel bearbeiten, sollten diese Aufgaben zentral und effizient in Servicecentern erledigt werden. Digitalisierung kann hier helfen, muss aber in eine tiefgreifende Verwaltungsreform eingebettet sein.
Sondervermögen als Game-Changer für eine neue Verwaltung
Wir müssen das Sondervermögen als Game-Changer für eine neue Verwaltung nutzen. Wir müssen unsere Verwaltung defragmentieren und die Aufgabenwahrnehmung bündeln, damit nicht mehr 10.000 Kommunen das Gleiche machen. Das geht weit über die Digitalisierung hinaus – das ist echte Transformation in dem Aufgaben, Organisation, Personal und Digitalisierung zusammendacht werden.
Die „Initiative für einen handlungsfähigen Staat – Reformen für eine starke Demokratie“ verfolgt das Ziel, die Effizienz und Bürgernähe der deutschen Verwaltung durch umfassende Reformen zu stärken. Sie hat in diesen Tagen einen Zwischenbericht vorgelegt, der bei den Koalitionären auf großes Interesse stößt. Eine der insgesamt 30 Empfehlungen fordert neue Regeln für die digitale Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Danach sollen für IT-Verfahren, die Bund, Länder und Kommunen betreffen, einheitliche Lösungen geschaffen werden.
Der Bund soll künftig allen Ländern und Kommunen zentrale Lösungen für folgende Aufgaben zur Verfügung stellen: zum Beispiel für die Kfz-Zulassung, das Um- und Abmeldewesen, das Führerscheinwesen und das Wohngeld. Das ist aber nur die halbe Miete. Noch sinnvoller wäre es, nicht nur zentrale Lösungen zur Verfügung zu stellen, sondern Aufgaben von der Antragstellung bis zum Bescheid komplett in zentralen Einrichtungen abzuwickeln, wie dies z.B. bei der Gewährung des Energiekostenzuschusses für Studierende geschehen ist.
Mit dem Sondervermögen hat Deutschland die historische Chance, die Verwaltung nicht nur digitaler, sondern grundsätzlich effizienter zu machen. Das muss aber jetzt geschehen. Doch ohne Strukturreformen werden auch 500 Milliarden Euro kaum nachhaltig wirken und Deutschland nicht voranbringen. (Franz-Reinhard Habbel)
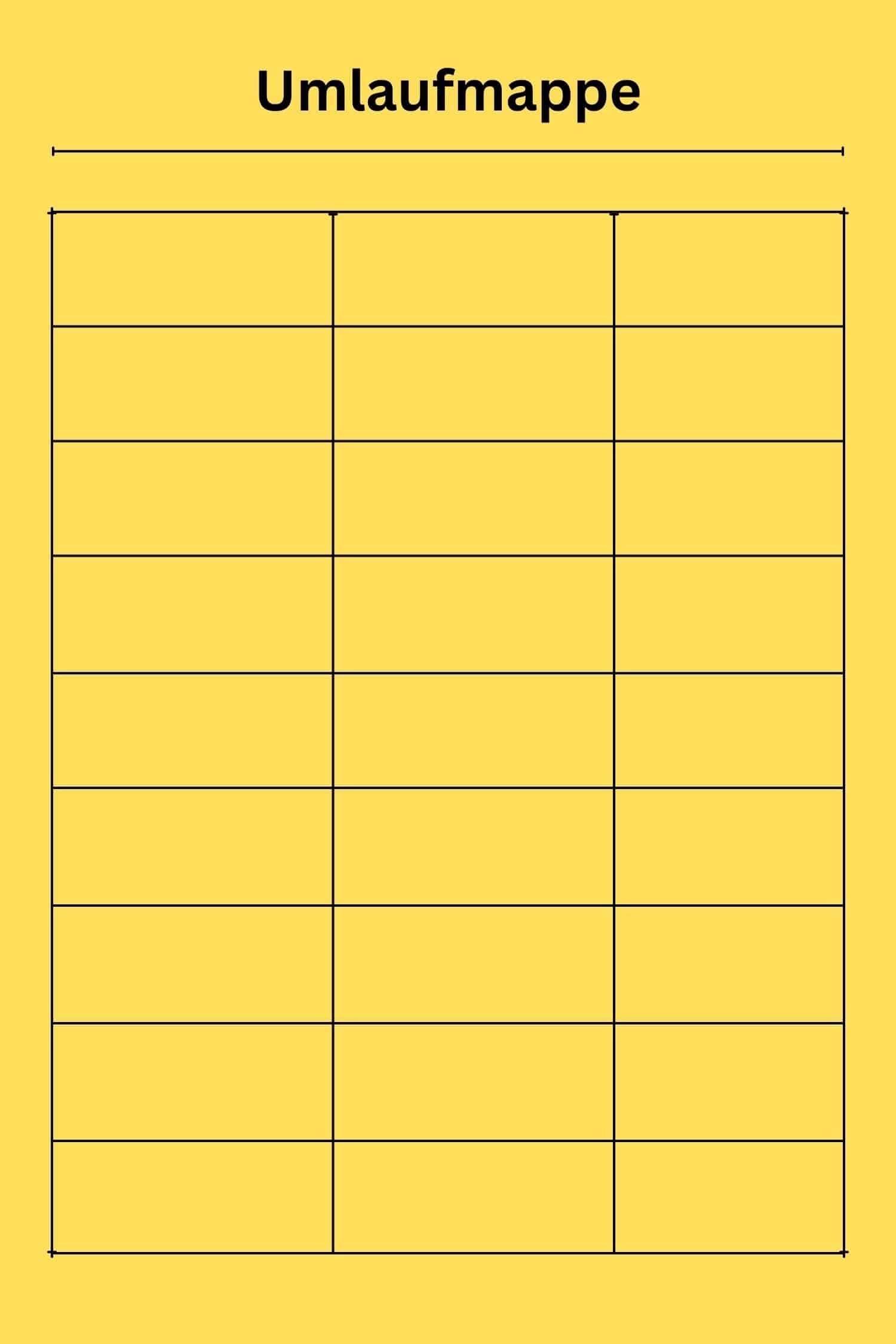
Neues aus den Kommunalen Spitzenverbänden
DST: Auf Infrastruktur-Paket muss ein Bürokratieabbau-Paket folgen
DStGB: Kommunen begrüßen Sondierungsergebnis: Wichtige Impulse für Entlastung und Investitionen
DLT: Die kommunale Finanznot muss in den Koalitionsvertrag
BayGT: Offener Brief an Alexander Dobrindt, Friedrich Merz und Lars Klingbeil
GStBRLP: BlitzReport März 2025
HSGB: „Heimat mit Zukunft – Ideen für Hessen“
SHGT: Startschuss für Wärmekompetenzzentrum
NWStGB: Investitionen in Infrastruktur dringend erforderlich
Städteverband SH: Die Wärmewende in Schleswig-Holstein nimmt weiter Fahrt auf: Wärmekompetenzzentrum und Wärmepotenzialkarten gehen an den Start
Kopf der Woche: Manuel Hagel, MdL leitet die AG 3 Digitales der KoaV
Buch der Woche: Zukunft im Widerspruch – Wie Deutschland sich jetzt neu erfinden muss Herausgeberband
Wer sich als Unternehmer, CEO oder Führungskraft einen Überblick über aktuelle Herausforderungen zu verschaffen versucht, kann durchaus Angst bekommen. Die vielzitierte „Polykrise“ ist in aller Munde und konfrontiert Unternehmen und ihre Entscheider:innen mit einer nie dagewesenen Anzahl von scheinbaren Gegensätzen, denen es unter Berücksichtigung zahlreicher unsicherer Variablen zu begegnen gilt. Die Schlüsselthemen Künstliche Intelligenz, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Arbeitsmarkt und Bildung konfrontieren Menschen mit vermeintlichen Widersprüchen. In diesem Buch lösen Expert:innen die vermeintlichen Widersprüche auf, zeigen, wie Deutschland sich jetzt neu erfinden muss, und machen Lust, den Wandel positiv zu gestalten.
++++Bitte denken Sie beim Kauf von Büchern an den örtlichen Buchhandel++++
Zahl der Woche: 16.000 Seiten Papier braucht es, um eine Kompanie in den Einsatz zu schicken. (Quelle: ThePioneer)
Chatbot der Woche: Landkreis Kehlheim
Tweet der Woche: Marcel Fratscher, DIW Präsident
Der „Kompromiss“ um das #Sondervermögen ist kein Zugeständnis an die Grünen, sondern ein Zugeständnis an die Vernunft – denn Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit wird davon abhängen, ob die grüne Transformation schnell und gut gelingen wird.
Zu guter Letzt: Mehr Punkte in Flensburg als Lebensjahre – 21-Jährige mehr als 100 Mal geblitzt
Image by Max Nüßler from Pixabay
Ihnen wurde der Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie in abonnieren

++++
Der ZMI kann kostenlos hier abonniert werden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ihr Franz-Reinhard Habbel