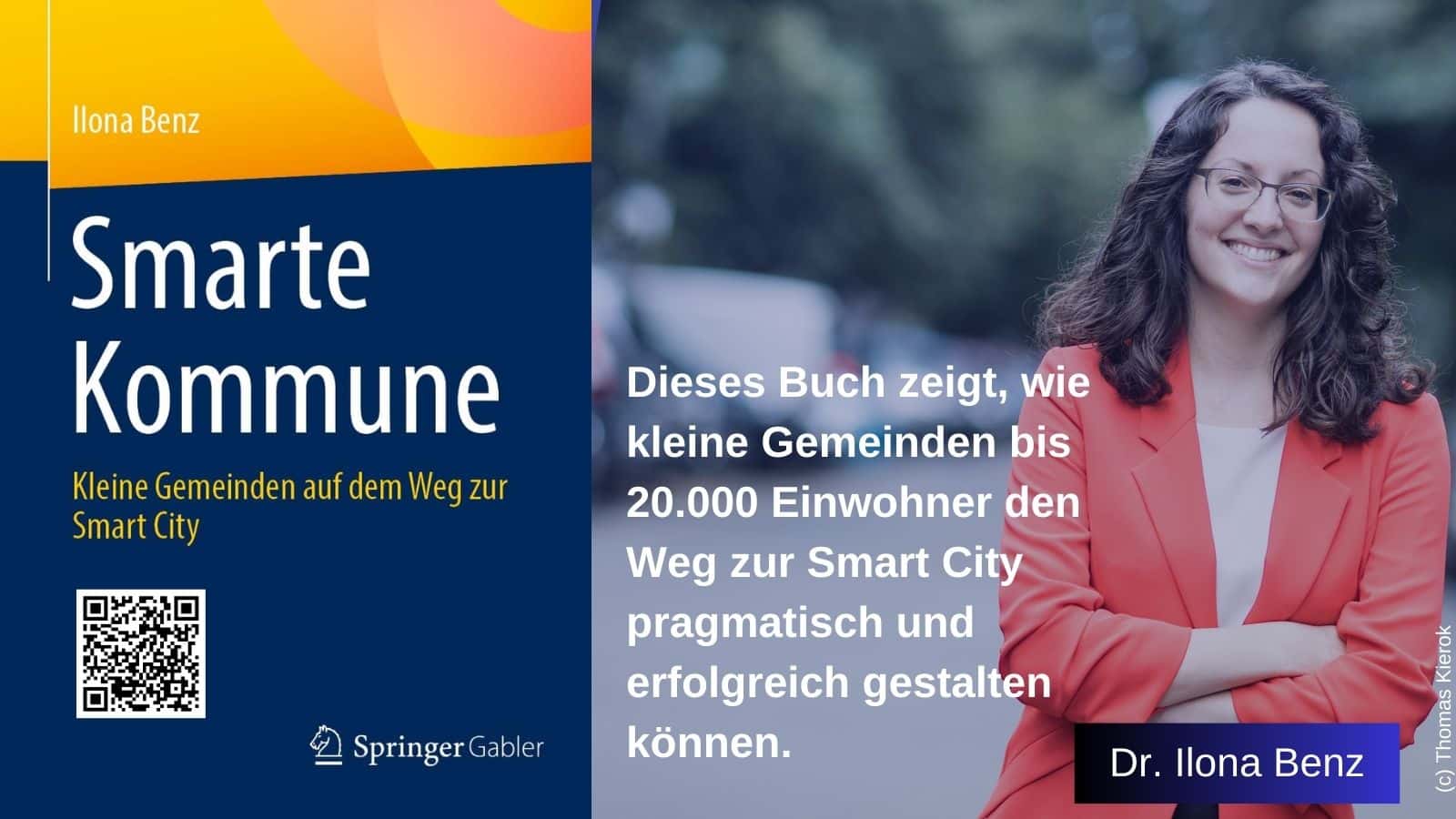Im Z-M-I, dem Zehn-Minuten-Internet Newsletter berichten Franz-Reinhard Habbel und Gerd Landsberg jeden Sonntag über interessante Links (heute u.a. Koalitionsvertrag CDU/CSU und SPD) aus dem Internet für Bürgermeister:innen und Kommunalpolitiker:innen.

Koalitionsvertrag „Verantwortung für Deutschland“

Das „Drehbuch“ für die Politik der nächsten vier Jahre liegt jetzt vor. In dieser Woche wurde von CDU/CSU und SPD der Koalitionsvertrag vorgestellt. Die CSU hat ihm bereits zugestimmt. Die SPD führt eine Mitgliederbefragung durch die am 29. April 2025 endet und die CDU befasst sich voraussichtlich am 28. April 2025 mit dem Papier. Auch wenn viele Maßnahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt, werden die Kommunen in den Kernpolitikbereichen profitieren. Eine erste Bewertung der kommunalen Spitzenverbände: DST, DStGB und DLT.
Grundgesetzänderung: Bund soll hochverschuldeten Gemeinden helfen können
Der Bundesrat hat am 11.4.2025 beschlossen, gegen den Entwurf einer Grundgesetzänderung, den die Bundesregierung noch in der letzten Legislaturperiode beim Bundesrat eingebracht hat, keine Einwände zu erheben. Die geplante Änderung würde dem Bund ermöglichen, einmalig die Hälfte der Altschulden von Kommunen zu übernehmen.
Schulden in Höhe von 31 Milliarden Euro: Viele Kommunen in Deutschland sind hoch verschuldet
Die zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommenen Schulden der Kommunen (Liquiditätskredite) beliefen sich Ende 2023 auf insgesamt rund 31 Milliarden Euro, heißt es in der Gesetzesbegründung. Der hohe Bestand an Krediten, die allein der Finanzierung struktureller Haushaltslöcher dienten, sei gerade in Verbindung mit der häufig vorhandenen Finanz- und Strukturschwäche der Gemeinden problematisch. Ohne Hilfe seien die Kommunen in absehbarer Zeit nicht in der Lage, ihre finanzielle Situation dauerhaft zu verbessern.
Einmalige Schuldenübernahme durch den Bund: Verantwortlich für die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden sind die Länder. Mit der Grundgesetzänderung soll der Bund jedoch in die Lage versetzt werden, einmalig die Hälfte der kommunalen Altschulden zu übernehmen. Voraussetzung ist, dass das jeweilige Land zuvor seine Kommunen vollständig von ihren Liquiditätskrediten entschuldet hat. Die Schuldenübernahme soll es Gemeinden ermöglichen, ihre Aufgaben ohne dauerhafte Schuldenlast zu erfüllen.
Gleichzeitig müssten die Länder für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sorgen. Die Bundesregierung fordert daher Maßnahmen, um insbesondere bei finanzschwachen Kommunen ein erneutes Anwachsen solcher Schuldenberge zu verhindern.
Wie es weitergeht: Nachdem der Bundesrat die Möglichkeit hatte, sich zum Entwurf der Grundgesetzänderung zu äußern, kann die Bundesregierung nun entscheiden, ob sie das Vorhaben beim neu gewählten Bundestag einbringt.
Naturgefahrenportal gestartet: Bevölkerung besser auf extreme Naturereignisse vorbereiten
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat das neue „Naturgefahrenportal“ live geschaltet. In dem Portal im Internet können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit aktuell über mögliche Naturgefahren wie Hochwasser oder Sturmflut an ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort in Deutschland informieren.
Europa soll bei Künstlicher Intelligenz unabhängiger von China und USA werden
Die EU-Kommission will die Regeln zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz vereinfachen und lockern.

Teuer erkauft – Tarifkompromiss auf Kosten der kommunalen Zukunftsfähigkeit
Der neue Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ist ein Befreiungsschlag – jedenfalls auf den ersten Blick. Streiks wurden vermieden, der Dienstbetrieb bleibt gesichert, und die Beschäftigten erhalten spürbare Verbesserungen: höhere Entgelte, angehobene Zulagen, zusätzliche Urlaubstage und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. All das ist ein Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden – und das zu Recht: Sie sind das Rückgrat jeder Verwaltung und das wichtigste Kapital der kommunalen Familie.
Doch so verständlich und menschlich diese Einigung ist, so problematisch sind ihre langfristigen Folgen. Denn der Kompromiss wird teuer – gerade für die Kommunen, die ohnehin am Limit wirtschaften. In Rheinland-Pfalz etwa verzeichneten die Städte, Gemeinden und Landkreise im Jahr 2024 ein Defizit von über 600 Millionen Euro. Und es gibt keine Anzeichen für eine Entspannung. Im Gegenteil: Die Einnahmesituation bleibt angespannt, die Ausgaben steigen – nicht zuletzt durch gesetzliche Vorgaben und soziale Pflichtaufgaben.
In dieser Lage wirkt der neue Tarifvertrag wie ein weiteres schweres Gewicht auf einer ohnehin überlasteten Waage. Die Kombination aus dauerhaften Lohnerhöhungen, ausgeweiteten Arbeitszeitregelungen und neuen Leistungsansprüchen schränkt die kommunalen Spielräume massiv ein. Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung oder Bildung werden erschwert, weil das Geld für Personalkosten gebunden ist. Die Gefahr ist groß, dass die Leistungsfähigkeit der Verwaltung nicht gestärkt, sondern geschwächt wird.
Natürlich: Ein attraktiver öffentlicher Dienst braucht faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Aber Tarifpolitik muss sich auch an der finanziellen Realität orientieren. Das Prinzip „mehr für alle, jederzeit und überall“ ist angesichts leerer Kassen nicht dauerhaft tragfähig. Es braucht endlich eine ehrliche Debatte über Prioritäten und Grenzen – und über die Frage, wie viel Staat wir uns künftig leisten können und wollen. Die Rahmenbedingungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst können zukünftig nicht ausschließlich über verbesserte Tarifabschlüsse verbessert werden. Die Entlastung der Menschen muss stärker über das Steuersystem und wirtschaftsstärkende Maßnahmen der kommenden Bundesregierung erfolgen.
Der Kompromiss schafft kurzfristig Ruhe. Doch er ist teuer erkauft – und droht langfristig die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Haushalte aufs Spiel zu setzen (Moritz Petry)
Bundesinnenministerium für Zivilschutz-Übungen an Schulen
Das Bundesinnenministerium hat sich für mehr Zivilschutzübungen an Schulen ausgesprochen.
„Die Energieverbräuche durch KI gehen durch die Decke“
Überall ist Künstliche Intelligenz eingebaut, selbst in Zahnbürsten, dabei verbraucht sie Unmengen an Strom. Der Forscher Rainer Rehak sagt, was wir tun können.

Ohne Wirtschaft kein Staat – und kein Sozialstaat
In der politischen Debatte ist eine zunehmend ablehnende Haltung gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern zu beobachten. Dabei wird oft übersehen, dass sie das Fundament unseres Wohlstands bilden. Ohne wirtschaftliche Leistungskraft gäbe es keine Arbeitsplätze, keine Steuereinnahmen – und damit auch keinen funktionierenden Staat, geschweige denn einen Sozialstaat.
Besonders kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) – das Rückgrat unserer Wirtschaft – stehen vielerorts massiv unter Druck. Hohe Energiepreise, überbordende Bürokratie und ein oft misstrauisches politisches Klima erschweren ihre tägliche Arbeit. Während in Berlin über Umverteilung diskutiert wird, sichern diese Betriebe vor Ort Stabilität, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt – oft in strukturschwachen Regionen, wo sie die Hauptarbeitgeber sind.
Auch kommunale Unternehmen wie Stadtwerke spielen eine entscheidende Rolle. Sie sind nicht nur bedeutende Arbeitgeber, sondern auch unverzichtbare Träger der Daseinsvorsorge – von Energie- und Wasserversorgung über Nahverkehr bis hin zur digitalen Infrastruktur. Ihre Verlässlichkeit macht viele Städte und Gemeinden erst zu attraktiven Standorten für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen.
Wer Unternehmergeist und wirtschaftliche Initiative ignoriert oder unter Generalverdacht stellt, gefährdet unsere Zukunft. Denn es sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Mut und Ideen Wandel gestalten, Innovationen vorantreiben und Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze schaffen. Der Fachkräftemangel, fehlende Unternehmensnachfolger und mangelnde Investitionen haben auch mit fehlender politischer Wertschätzung zu tun.
Die Politik muss umdenken: Statt Wirtschaft als Problem zu behandeln, sollte sie sie als Partner verstehen. Ohne eine starke, vielfältige und verlässliche Wirtschaft kann kein Staat dauerhaft bestehen – und ein Sozialstaat schon gar nicht.
Was es braucht, ist mehr Austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Ein Perspektivwechsel – etwa durch temporäre Wechsel von Fachkräften zwischen beiden Bereichen – würde das gegenseitige Verständnis fördern und helfen, realitätsnähere und effektivere Lösungen zu entwickeln. Gerade in Zeiten multipler Krisen zeigt sich: Der Staat allein kann es nicht richten. Nur gemeinsam mit einer starken Wirtschaft wird Zukunft möglich. (Gerd Landsberg)

Effizienz kostet – und darf es auch
Wieder einmal steht der Fahrdienst des Bundestags in der Kritik. 15,3 Millionen Euro im Jahr 2024 – das klingt viel. Und ja, es ist ein erheblicher Betrag. Doch bei aller berechtigter Aufmerksamkeit für Haushaltsdisziplin sollten wir nicht vergessen: Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Unsere Bundestagsabgeordneten tragen Verantwortung für über 80 Millionen Menschen. Sie sollen Gesetze prüfen, Interessen vertreten, Termine wahrnehmen – und zwar oft im Minutentakt.
Wer den politischen Alltag kennt, weiß: Ohne Fahrdienst geht es schlicht nicht. Im dicht getakteten Berliner Politikbetrieb können Abgeordnete nicht auf Bus und Bahn vertrauen – so gut der ÖPNV in der Hauptstadt auch ausgebaut sein mag. Es geht nicht um Bequemlichkeit, sondern um Effizienz und Sicherheit.
Dass die Kosten gestiegen sind, liegt laut Bundestagsverwaltung vor allem an höheren Löhnen und Nebenkosten. Die Zahl der Fahrten hingegen ist seit der Vor-Corona-Zeit sogar deutlich zurückgegangen. Insofern ist die Empörung über die Millionen-Ausgaben oft eher populistisch als sachlich.
Natürlich muss ein solches System regelmäßig auf Sinn und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Transparenz und Kontrolle sind wichtig – gerade bei staatlichen Ausgaben. Doch wer ernsthaft will, dass Politik effektiv, schnell und reaktionsfähig bleibt, sollte den Fahrdienst nicht als Luxus verteufeln, sondern als notwendige Infrastruktur begreifen.
Ohne Internet: Gut vier Prozent der Deutschen leben offline
Shopping, Überweisungen, Filme anschauen – vieles läuft heute online. Doch gut vier Prozent der 16- bis 74-Jährigen haben das Internet noch nie genutzt. Die Zahl der Nichtnutzer geht aber zurück.
Datenzentren brauchen bis 2030 doppelt so viel Strom
Rechenzentren werden bis 2030 deutlich mehr Strom benötigen, prognostiziert die Internationale Energieagentur. In den USA werden die Rechenzentren demnach mehr Strom verbrauchen als die Produktion aller energieintensiven Güter zusammen.
Rahmenvertrag: MS-365-Alternative OpenDesk soll die Bundeswehr erobern
Das IT-Systemhaus der Bundeswehr BWI hat mit Zendis einen Rahmenvertrag über „souveräne Kommunikations- und Kollaborationslösungen“ wie OpenDesk geschlossen.

Digitalisierung muss strategischer Kern künftiger Regierungsarbeit sein
Die Digitalisierung nimmt im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD einen prominenten Platz ein. Sie bildet neben der Staatsmodernisierung eine wichtige Grundlage, um die Handlungsfähigkeit des Staates auch in Zukunft sicherzustellen. Es ist erfreulich, dass das neu zu schaffende Ministerium auch die Staatsmodernisierung und den Bürokratieabbau umfasst. Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung müssen zusammen gedacht werden. Nur so kann der notwendige Umbau des Staates gelingen.
„Grundlegende Strukturreformen sind eine Gelingensbedingung für den Erfolg unserer Regierung. Wir erarbeiten in 2025 eine ambitionierte Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung, durch die wir unter anderem die Bundesverwaltung ressortübergreifend modernisieren, einen Effizienzfonds einführen und unseren Staat insgesamt von den Bürgerinnen und Bürgern her denken“, heißt es in der Vereinbarung.
Viele dieser Maßnahmen sind nicht neu. Was der Vertrag aber deutlich macht, ist der unbedingte Wille, die Verwaltung zu modernisieren, sie effizienter und serviceorientierter zu machen.
So finden sich das Digital-Only-Prinzip, eine zentrale Plattform (One-Stop-Only), ein verpflichtendes Bürgerkonto, die digitale ID und das EUDI-Wallet als Standards wieder. Wer den digitalen Weg nicht gehen will oder kann, bekommt Hilfe vor Ort. Ziel der neuen Koalition ist eine Verwaltungskonsolidierung, die Aufgabenkritik, Personaleinsparungen und Verwaltungsreform beinhaltet. Der Personalbestand in der Ministerial- und Bundestagsverwaltung soll um acht Prozent reduziert werden. Außerdem soll die Zahl der derzeit 950 Bundesbehörden durch Zusammenlegung und Abbau von Redundanzen verringert werden. Erfreulich ist die Absicht, standardisierbare Aufgaben wie Personal, IT, Datenschutz, Vergabe und Beschaffung sowie Compliance und übergreifende Kommunikationsmaßnahmen in leistungsfähigen gebündelten Serviceeinheiten zusammenzufassen. Die in der Verwaltung vorhandenen Daten sollen stärker genutzt werden, insbesondere für KI-Anwendungen, die das Verwaltungshandeln künftig wesentlich prägen werden. Die föderalen Beziehungen sollen durch einen Zukunftspakt von Bund, Ländern und Kommunen neu geordnet werden. Ein interoperabler und europäisch anschlussfähiger Sovereign Germany Stack soll KI, Cloud-Dienste und Basiskomponenten integrieren.
Neu ist die Einführung einer antragslosen Verwaltung. Sie entwickelt sich zu einem Megatrend, der bereits international diskutiert wird.
Eltern sollen zum Beispiel nach der Geburt eines Kindes automatisch einen Kindergeldbescheid erhalten. Dies setzt eine Modernisierung der Register voraus. Um diese neuen Möglichkeiten zu beschleunigen, sollte der Bund zügig erste Fälle identifizieren und schnell die Voraussetzungen für eine antragslose Abwicklung schaffen. Der Bund sollte Bürokratieabbau im Rahmen eines Verwaltungsdigitalisierungsgesetzes betreiben, in dem z.B. alle rechtlichen digitalen Elemente gebündelt werden. Ein solches „digitales Gesetzbuch“ könnte für die digitale Welt eine ähnliche Wirkung entfalten wie die Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 1. Juli 1896.
Wichtig wird es sein, die im Koalitionsvertrag genannten Maßnahmen und Möglichkeiten der Digitalisierung in alle Ressorts und damit in die gesamte Bundesverwaltung zu tragen und dort mit Leben zu füllen. Die Verwaltung muss künftig schneller, zielgerichteter und wirkungsorientierter arbeiten. Politik wirkt nur, wenn sie schnell umgesetzt wird. Das gilt zum Beispiel für das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket. Neue Arbeitsformen, flache Hierarchien und die Einbindung von IT-Unternehmen, aber auch von Kommunen und Experten der Zivilgesellschaft in die Arbeit des neuen Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung sind dringend notwendig. Reallabore, Sandboxes und andere Experimentierräume könnten in diesem Ministerium zur Startrampe für neues, modernes, vernetztes Regierungshandeln werden. Digitalisierung ist der strategische Kern künftigen Regierungshandelns. Der neue Bundeskanzler sollte sich als „Digitalminister“ verstehen und damit seiner Führungsverantwortung gerecht werden.
Letztlich geht es um die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die kommenden Jahre werden uns angesichts zu erwartender weiterer geopolitischer Verwerfungen und Neuorientierungen viel abverlangen. Auch ein Koalitionsvertrag ist keine Steintafel, die nicht mehr verändert werden kann. Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, den Mut zu haben, das Richtige und Notwendige zu tun, sich Veränderungen zu stellen und sich neu aufzustellen, sollte die zentrale Grundlage der künftigen Regierungsarbeit sein. Das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. Es sollte mit gutem Beispiel vorangehen und nicht selbst als erste eine eigene Z-Abteilung gründen, sondern hier auf zentrale Serviceeinheiten setzen bzw. mit anderen Ressorts sprechen, wie so etwas gemeinsam gemacht werden kann. Das neue Ministerium kann zur Quelle eines modernen Regierungshandelns werden, in dem neue Formen der Kooperation und Zusammenarbeit, der Aufgabenbündelung und des Einsatzes von modernen Kommunikationsinstrumenten für die strategische Ausrichtung des Staates in einem vernetzten Europa praktiziert werden.
Angesichts der gewaltigen Herausforderungen, die vor uns liegen, gilt es, groß zu denken und mehr Mut zu haben, Neues auszuprobieren. Es ist vielleicht die letzte Chance, das traditionelle Verwaltungshandeln hinter uns zu lassen. (Franz-Reinhard Habbel)
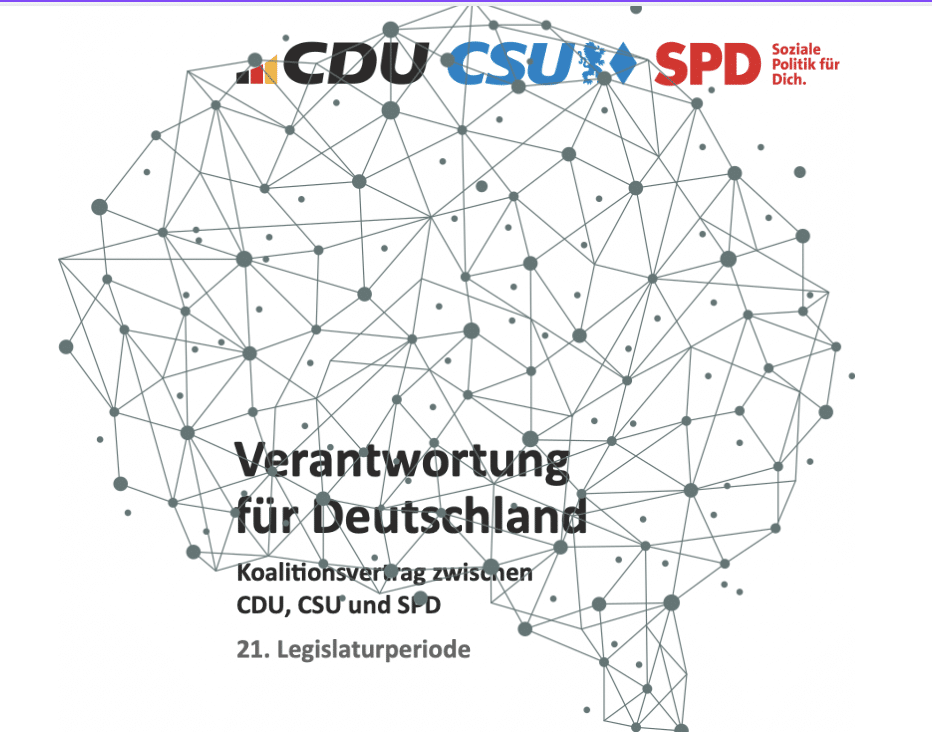
Neues aus den Kommunalen Spitzenverbänden
DStGB: Kommunen begrüßen Einigung auf Koalitionsvertrag – Jetzt kommt es auf die Umsetzung an
DLT: Der Koalitionsvertrag enthält für die Kommunen zu wenig Belastbares
GStBRLP: Jenaer Erklärung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE): Europa gemeinsam stark machen!
HSGB: Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ geht in die nächste Runde
HST: Grundrechtsklage gegen das Land in Sachen Cannabis eingereicht
SSGT: SSGT zum Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD
SSG-Sachsen: Mitgliederversammlung 2025 in Leipzig
SHGT: „Landesanteil für Ganztagsausbau nutzen“
NWSTGB: Koalitionsvertrag enthält wichtige Ansätze
STGTMV: Eine große Idee scheitert an den Realitäten – Oder das Märchen aus Tausendundeiner Nacht…
Kopf der Woche: Louisa Solonar-Unterasinger, neue CIO des Landes Hessen
Buch der Woche: Aufbruch von Stefan Klein
Klimakrise und künstliche Intelligenz, die alternde Gesellschaft und internationale Konflikte fordern uns heraus. Wir müssen uns selbst und die Welt verändern, wenn wir überleben wollen. Warum klammern wir uns dann an alte Gewohnheiten und falsche Gewissheiten, statt den Wandel jetzt anzugehen?
+++Denken Sie beim Erwerb von Büchern an den örtlichen Buchhandel+++
Zahl der Woche: Jeder 6.Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren hat schon Cybermobbing erlebt, sagt eine Studie des Sinus-Instituts (Quelle: destatis)
Chatbot der Woche: Chatbot der Stadt Ludwigsburg
Tweet der Woche: Patrick Kunkel, Bürgermeister Eltville am Rhein
Ich bin keine ActionFigur. …keine KI, …aber hier mache ich gleich etwas Action
Zu guter Letzt: Maschine muss umkehren – Falsches Essen: Passagier rastet im Flugzeug aus
Ihnen wurde der Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie in abonnieren

++++
Der ZMI kann kostenlos hier abonniert werden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ihr Franz-Reinhard Habbel